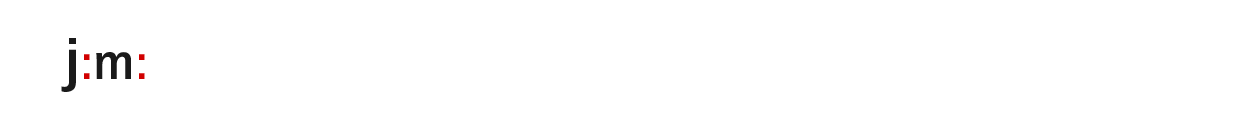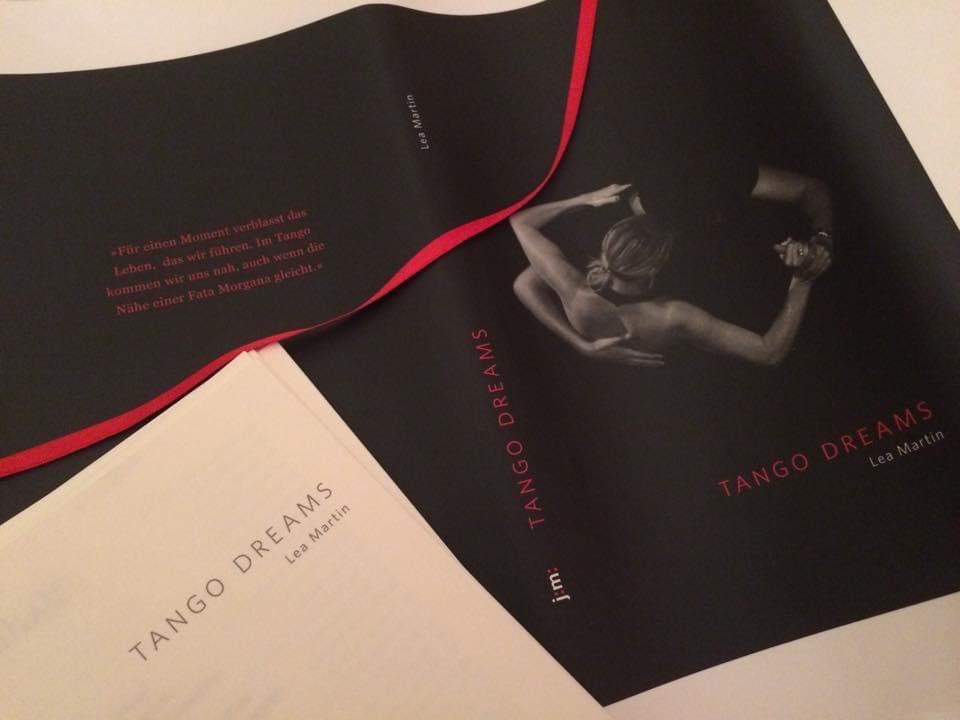Gedichte und Gespräche: Katharina Schäfer besucht Menschen zu Hause und erzählt über die Schoa
von Katja Winckler
Kämpfen tut sie heute noch mit ihrem Vater. Obwohl er schon seit Jahren tot ist. Immer wenn ihr Vater beim Kaffeetisch begeistert von Hitlers Autobahnen sprach, bekam er plötzlich diesen schmalen Mund unter dem gestutzten Oberlippenbart. Die Arbeitslager müßten wieder her, sagte er dann mit messerscharfer Stimme, für die Zivildienstleistenden, die „Drückeberger“. Ein normaler Sonntagnachmittag im Elternhaus von Katharina Schäfer, Ende der siebziger Jahre. Damals war Katharina Schäfer fünfzehn Jahre alt. Die Reden ihres Vaters im Kreise der Verwandtschaft erfüllten sie damals schon mit Wut und Ohnmacht. Wenn sie versuchte dagegen zu argumentieren, fiel ihr die Mutter in den Rücken. Irgendwann lag dass die Broschüre Die Auschwitzlüge auf dem Wohnzimmertisch. Ob aus Nachlässigkeit oder um sie zu provozieren, das weiß die Zweiundvierzigjährige bis heute nicht. „Da bin ich innerlich aus der Familie ausgestiegen“, sagt die schlanke Frau mit den braunen, halblinken und Haaren und den traurigen AugenKatharina Schäfer hat mit ihren Kindheitserinnerungen und dem Muff bundesdeutscher Nachkriegswohnzimmer noch immer nicht abgeschlossen. Sie versucht vielmehr ihre Erlebnisse konstruktiv zu verarbeiten. Sie geht zurück an den Tatort. Wer sich bei ihr anmeldet kann Freunde und Bekannte zu sich nach Hause einladen. Dann zückt die Schriftstellerin, ehemalige Journalistin und dreifache Mutter mit ihrem Gedichtband Weil ich keine Jüdin bin und einem großen Kassettenrekorder und dem Arm an – nach dem Prinzip der wieder beliebten Tupperpartys. Aber statt bunter Plastikschüsseln werden Gedanken zu einem dunklen Thema ausgetauscht – Auschwitz: Gedichte als Anstoß für Gespräche. Die möchte Katharina Schäfer allerdings nicht in die Öffentlichkeit, sondern in den privaten Raum verlegen. Aus gutem Grund, wie sie glaubt. „Bei uns gibt es viele antisemitische und ausländerfeindliche Tabus, die höchstens am Stammtisch oder hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen werden. Dagegen möchte ich angehen.“
Vor zwei Jahren begann Schäfer mit ihren ersten Hausbesuchen. Mittlerweile wird das Projekt von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur gefördert. Mit Gratis-Postkarten in Kneipen und Buchhandlungen wirbt die Autorin für ihre Veranstaltungen. Viel läuft auch über Mund zu Mund Propaganda. Begleitet wird Schäfer immer von einem Fotografen, der die Privaträume, in denen die Lesungen stattfinden, ablichtet. Allerdings ohne Menschen. Das gehört zum Konzept. Schließlich geht es um freie GedankenRäume, und die Teilnehmer sollen anonym bleiben. Wer will, kann sich später vom Literaturwissenschaftler Cem Sengül interviewen lassen. Die Aufzeichnungen und Fotografien sollen irgendwann mal ausgestellt werden. Außerdem ist ein Buch geplant.
Die Gespräche gehen häufig richtig ins „Eingemachte“. Gefühle spielen eine große Rolle. Wie beispielsweise in einer Neuköllner Studenten WG. Ein schwarz-roter Sterin, Che Guevara und ein Sesamstraße-Plakat hängen an der Wand. Dazu ein Fünfziger-Jahre-Küchentisch, darunter ein Flickenteppich, die Stühle bunt zusammengewürfelt. Der Gastgeber mit Kinnbart und im Ökolook kocht Kaffe und legt im Ofen noch mal Holz nach. Um den Küchentisch haben sich seine alternativ angehauchten Freunde und Bekannten, alle etwa um die fünfundzwanzig, versammelt. Außerdem sind drei angehende Erzieherinnen mit Lippenpiercing, Jeans und Trainingsjacken gekommen. Sie gehören nicht zur studentischen Gruppe, sondern sind von Katharina Schäfer eingeladen worden, weil sie in der Schule an einem Projekt zum Thema Nationalsozialismus teilnehmen sollen.
Mit dem Satz „Am Anfang der Lyrik stand die Sprachlosigkeit“ leitet Katharina Schäfer ihre Gedichte ein. Sie handeln von der Ermordung von Millionen unschuldigen Menschen, dem Schweigen über die braune Vergangenheit in den Gründerjahren der Bundesrepublik, aber auch vom Schuldgefühl der Nachgeborenen und der Täterkinder. Die zwischendurch eingespielte Musik – Klemmer, Hanns Eislers „Konzentrationslagersymphonie“ und jüdische Lieder – stimuliert den Betroffenheitsnerv. Später gesteht Katharina Schäfer der Gruppe: „Als ich zur Schule ging, erfuhr ich, daß mein Vater der Waffen SS angehörte. Das überfordert mich noch heute.“ Als Journalistin hat sich Schäfer nie mit ihrem Thema auseinandergesetzt. Dafür hat sie sich irgendwann über Theodor W. Adornos Diktum, daß es barbarisch sei, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, hinweggesetzt – und geschrieben. Zunächst nur für die Schublade. Vor vier Jahren dann brachte sie ihre Gedichte im Eigenverlag heraus.
Als Katharina Schäfer verstummt, herrscht erst einmal Schweigen in der Neukölln Wohnküche. Nur das Knistern und Knacken des Holzes im Ofen ist zu hören. Ab und zu ein verlegenes Räuspern. Dann mach ein junger Mann den Anfang. Es klingt ein wenig alibimäßig, als ob er das Gefühl habe, etwas sagen zu müssen: „Ich habe das Gefühl, sehr viel erfahren zu haben, gar nicht so sehr inhaltlich, sondern emotional.“ Ganz anders eines der gepiercten Mädchen. “ Mich berührt das gar nicht. Ich habe damit ja gar nichts zu tun, weil ich daran ja gar nicht beteiligt war. natürlich darf so etwas nicht wieder vorkommen“, sagt die junge Frau ganz nüchtern. Ihre Freundinnen nicken. Jetzt kommt Bewegung in die bunt zusammengewürfelte Gruppe. Eine der Studentinnen sagt: „Mich erschreckt es, daß es Leute gibt, die das nicht berührt.“ Sie habe Angst, daß das Gespür für das, was geschehen ist, verlorengehe. „Ich wurde von meinen Mitschülern als kalt abgestempelt, weil ich in Ravensbrück nicht geweint habe“, kontert das gepiercte Mädchen, „Aber Deutsche waren genauso Opfer. Meine Oma war in russischer Gefangenschaft. Sie war Opfer und nicht Täterin. Sie kann bis heute nicht darüber sprechen, was damals passiert ist, sondern nur weinen.“ Es kommt zu keiner Einigung. Die Schülerinnen wollen los. Dennoch ist Katharina Schäfer mit der etwa zweieinhalbstündigen Sitzung zufrieden. Immerhin sei ein Sprechen über die Sprachlosigkeit gelungen. Und die Schülerinnen hätten sich trotz ihres zuweilen schroffen Verhaltens erstaunlicherweise doch dazu bereit erklärt, sich noch mal in Ruhe interviewen zu lassen. Ein Abend, der zeigt, daß das Thema auch in der zweiten und dritten Generation berührt und so ganz unterschiedliche Gefühle auslöst.
Zuweilen fließen sogar Tränen. So brach es bei einer anderen Sitzung aus einer Lehrerin heraus, daß ihr Großvater Aufseher in einem NS-Konzentrationslager war. „Genau das will ich. Einen Raum schaffen, in dem nicht vom Gefühl abgeschnitten über die Vergangenheit gesprochen wird“ , sagt Katharina Schäfer. Die Menschen entwickelten unterschiedliche Strategien, um mit dem Gehörten umzugehen. Männer schwenkten schnell zu rationalen Ebene um, Frauen fragten, wie man im Alltag mit dem Thema umgeht, etwa wenn die Kinder fragen: Was war denn der Holocaust?
Doch es gibt auch Missverständnisse. Manchmal sogar zwischen scheinbar Gleichgesinnten. Zum Beispiel bei einer internationalen Gruppe mit deutschen, australischen und amerikanischen Studenten, die sich zu einer „Arbeitsgruppe Holocaust“ zusammengeschlossen und gemeinsam Auschwitz besucht hatten. Nach Schäfers Lesung hatte ein australischer Teilnehmerin immer „Germans“ und „Jews“ unterschieden. Als ihr eine Studentin deutlich zu machen versuchte, daß es auch deutsche Juden gibt, verstand die australische Kommilitonin sie nicht. Schäfer erklärt das mit „kulturellen Barrieren“. Manchmal passiert es ihr auch, daß junge Menschen sie fragen, was sie denn fühlen sollen. Als sie beispielsweise eine Gruppe von Zivildienstleistenden besuchte, fragten diese, was sie denn angesichts dieses traurigen Themas fühlen sollen. „Als wenn ich eine Autorität sei, die ihnen sagen muß, wie man richtig trauert“, sagt sie und schüttelt dabei den Kopf.
Obwohl sich Katharina Schäfer seit vielen Jahren mit diesem Phänomenen beschäftigt, wirkt sie immer noch ein wenig erstaunt, verständnisvoll und so gar nicht abgeklärt. Der Vater ist ihr bis heute ein Rätsel geblieben. Lutz bevor er starb, erzählte er ihr, daß er einmal gesehen habe, wie jüdische Menschen von den Nazis abtransportiert wurden. Was er dabei empfunden hat, darüber erfuhr seine Tochter nichts. Sie hat auch nicht gefragt. Als die Autorin mit dem Gedichtschreiben anfing, fragte ihre Tante: „Kannst du nicht über etwas Erfreulicheres schreiben?“ Da hat sie geschwiegen. Und als ihr erstes Kind unterwegs war und sie überlegte ihm den Namen Sara zu geben, zischte ihre Großmutter über ihrem Strickzeug: „Das ist ja ein jüdischer Name!“ Auch da ist sie stumm geblieben und hat einen Rückzieher gemacht. „Ich fand ihn zu demonstrativ“, sagt sie heute eine Spur zu heftig, als ob sie sich vor sich selbst verteidigen müsse, daß sie der Familie nicht stärker Contra gegeben hat. Vielleicht muß Katharina Schäfer deswegen weitermachen und vor fremden Türen stehen, mit ihrem Buch und ihrem Kassettenrekorder unter dem Arm.
Aber auch außerhalb ihrer Familie handelt sie sich regelmäßig Abfuhren ein. Als sie im Heimatmuseum Tempelhof lesen wollte, fragten eine scheinheilig, ob ihre Gedichte nicht zu anspruchsvoll seien. Andere posaunten: „Da kommen wir nicht hin.“ Ein Stadtmagazin lehnte einen Bericht über die Schriftstellerin ab. Angeblich kenne die Radaktion das Thema „Auschwitz“ nicht mehr hören. „Diese heftigen Reaktionen sind schon bemerkenswert“, finden die Vorleserin. Daß sich vor kurzem das erste Mal ein jüdischer Interessent bei ihr meldete, freut sie. Als Schäfer ihren Gedichtband herausbrachte, hat ihr die Mutter gratuliert. Über den Inhalt haben sie bis heute nicht gesprochen.
19.02.2004 , Jüdische Allgemeine / Publik-Forum 2004 Nr. 10